
Wir leben in verstörenden Zeiten. In einer sich immer schneller transformierenden Welt gerät die Anpassungsfähigkeit der Menschen an ihre Grenzen – vor allem, weil wir uns selbst im Weg stehen. So sieht das zumindest Vince Ebert, der Meister der Ratio. Der Wissenschaftskabarettist wollte eigentlich gar kein neues Programm mehr schreiben, gerade weil er mit seinen Erklärungen kaum noch mit dem Fortschritt mithalten konnte, doch seinem Seelenfrieden zuliebe hat er sich noch einmal aufgerafft und mit „Vince of Change“ die soziologischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte in den Mittelpunkt gestellt. Doch jenseits der von ihm verehrten Naturwissenschaften verheddert sich der 57-Jährige mitunter in Kommentaren über Befindlichkeiten, verzichtet auf eine klare Linienführung und verschießt scheinbar ziellos eine Pointe nach der anderen, oftmals plump – und deshalb mitunter ganz schön gefährlich.
Werbeanzeige
Eigentlich ist Vince Ebert immer ein Mann der Fakten gewesen. Der studierte Physiker war und ist ein Meister darin, jenseits von gefühlten und geglaubten Wahrheiten zu vermitteln, was die Welt im Innersten zusammenhält. Gerade deshalb sind ihm Gender-Debatten und vom Bauchgefühl beeinflusste Politik ein Graus. Im Haus der Springmaus, wo er am Wochenende zwei ausverkaufte Abende bestritt, bezieht er dagegen Stellung und beklagt eine „verklemmte, spießige Biedermeier-Zeit“, in der Toleranz zum Problem wird. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Natürlich, und Ebert liefert auch einige überzeugende Argumente, insbesondere dann, wenn es um emotional aufgeblähten Aktionismus geht, bei dem die Logik auf der Strecke bleibt. Wenn Touristen auf Langeoog Rettungsfahrzeuge blockieren, weil es sich immerhin um eine autofreie Insel handelt, oder wenn in einer Kolonialismus-Ausstellung in bestimmten Zeiträumen weiße Besucherinnen und Besucher unerwünscht sind, zeigt sich die Absurdität der heutigen Zeit. Und wenn etwa eine Wissenschaftlerin, die einen Vortrag über die zwei biologischen Geschlechter halten will, von ihrer eigenen Universität ausgeladen und von Studierenden als queer- und transfeindlich beschimpft wird, ist offensichtlich, dass Fakten mit Ideologien bekämpft werden. „Nur weil sich jemand beleidigt fühlt, heißt das nicht, dass er recht hat“, sagt Ebert dazu und verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Satire, die eigentlich gerade deshalb alles thematisieren darf, weil Humor im besten Fall selbst verhärtete Fronten zum Einsturz bringt. „Lachen verwandelt Mauern in Fenster“, fasst es Ebert zusammen.
An anderer Stelle macht Ebert es sich dagegen zu leicht. Mitunter reiht er einfach nur einen Witz an den nächsten, verfeuert ein Pointenfeuerwerk und bleibt trotzdem oberflächlich, statt in die Tiefe zu gehen. Zugegeben, das ist bei gewissen Themen schwierig, zumal Ebert kein Geisteswissenschaftler ist, aber trotzdem sollte sein Anspruch sein, die von ihm benannten Probleme auch analytisch angehen zu können. Stattdessen beginnt er, etwa gegen eine Frauenquote zu polemisieren, karikiert den postmodernen, woken Zeitgeist und beschwert sich über eine Minderheit von Apokalyptikern, die angesichts des Klimawandels den Niedergang der Welt herbeirufen. Da werden die Kinder nicht mehr so gefordert wie noch zu seiner Jugend, als noch nicht alle „Jammerlappen“ waren und nur die wenigsten nach dem Abitur auf die Suche nach sich selbst gingen. Ja, früher war alles besser. Das ist banal, vor allem für Vince Ebert.
Warum ausgerechnet er in der zweiten Hälfte seines Programms auf einmal auf den gewöhnlichen Comedy-Zug aufspringen muss und von den Unterschieden zwischen Deutschen und Österreichern erzählt – Ebert selbst lebt seit inzwischen fünf Jahren mit seiner Frau in Wien –, so wie es jeder zweite Kleinkünstler tut, bleibt ein Rätsel. Denn eigentlich hat er derartige Gags nicht nötig.
Dabei meint Vince Ebert es doch eigentlich nur gut. Er verordnet Deutschland in einer mentalen Rezession, überfordert und in alten Mustern verharrend, scheinbar ohne Ausweg. Ein neues Denken könnte die Lösung sein, glaubt Ebert, eines voller Wagemut, Leistungsbereitschaft und Selbstbestimmung. „Weil wir nicht wissen, was wir haben, fragen wir uns immer, was uns fehlt“, betont er. Ein schöner Satz, der allerdings keine Antworten liefert. Wie auch? Immerhin geht es hier nicht um wissenschaftliche Phänomene, sondern um Menschen. Und die sind nun einmal vieles. Vor allem irrational.

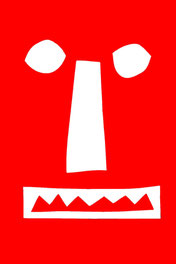





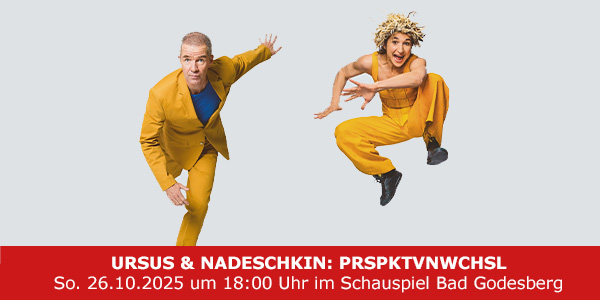







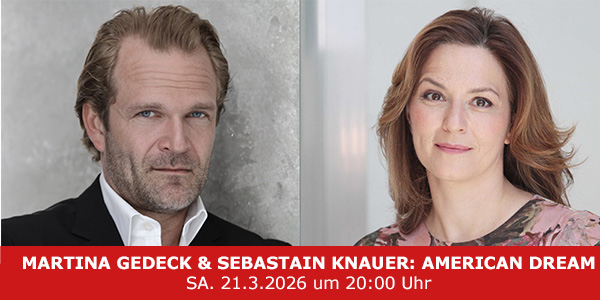

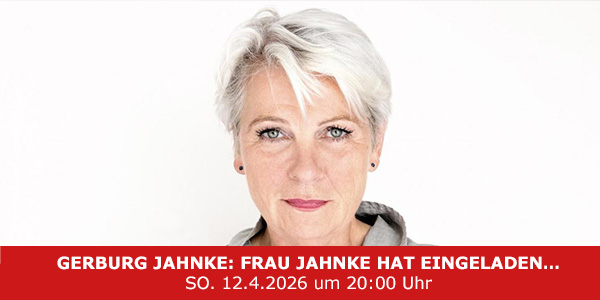












Kommentar schreiben